In einem Leichtbauwelt-Beitrag berichteten wir im Juni 2020 darüber, dass Forschende der Technischen Hochschule Mittelhessen untersuchen, inwieweit sich das Metall-Laserstrahlschmelzen nutzen lässt, um tragende Leichtbaustrukturen für den Automobilbau herzustellen.
Wie hat sich das Projekt entwickelt?

Das Team ist heute einen großen Schritt weiter: Das Projekt hat sich von einem Konzept zu einem anwendungsnahen Validierungsstand weiterentwickelt. Fertigungsparameter und Belichtungsstrategien im SLM wurden so angepasst, dass sich funktional gradierte Bauteile aus der Aluminiumlegierung AlSi10Mg zuverlässig erzeugen lassen. Die Forschenden konnten einen additiv gefertigter Bremssattel konstruieren, drucken und zyklisch prüfen.
Den Labormaßstab hat die Technologie verlassen. Die Forschenden arbeiten derzeit in einer Kooperation mit Continental und der TU Darmstadt zur Implementierung eines Lebensdauermodels. Humorvoll – und auch ein bisschen stolz – wurde der Redaktion von Leichtbauwelt auf Nachfrage mitgeteilt, man sei vom Status „geht theoretisch“ zum Status „geht praktisch – mit Vorbehalten“ fortgeschritten.
Welche Fortschritte konnten erzielt werden?
Ein konkreter Meilenstein sei abgeschlossen: In seiner Dissertation, die am 14.05.2024 eingereicht wurde, hatte Andreas Kern serienähnliche Proben und ein Muster eines Bremssattels beim Industriepartner Continental produziert und mechanisch erfolgreich geprüft. Im Ergebnis stehen eine Gewichtsersparnis von etwa 26 Prozent. Dazu liegen außerdem umfangreiche Wöhler- und Rissfortschrittsdaten, CT-Analysen und metallografische Daten vor. Weiterhin wurde ein Python-Tool zur Lebensdauer-Prognose implementiert und mit Versuchen validiert.
Wo steht die Technologie heute – und welches Potenzial hat sie?
Weniger Masse, gleiche Sicherheit: Die Kombination aus lokal gradierter Porosität und einem validierten Lebensdauermodell erlaubt komponentenspezifische Materialeinsparung bei gesicherter Funktion. Praktisch bedeutet das viele handfeste Vorteile für die spätere industrielle Serienanwendung:
- eine bessere Topologie-/Struktur-Optimierung,
- kürzere Entwicklungszyklen,
- gezielter Einsatz von Porosität statt Gitterstrukturen und
- Impulse für nachhaltigere Fertigungsbilanzen durch Materialreduktion und effizientere Bauteilgestaltung.
Wichtige Voraussetzung, um von diesen Vorteilen (künftig) zu profitieren, seien aber Skalierung, Integration in Slicer und eine weitergehende Validierung.
Welchen Beitrag leistet die Entwicklung zum Leichtbau?
Derartige Leichtbau-Entwicklungen sind in einer Hochschule für angewandte Wissenschaften wie der THM praxisnahe Hebel: Sie fördern Industriekooperationen, schulen Ingenieurinnen/Ingenieure im Transfer von Methode zu Anwendung und stärken die Marktposition durch anwendungsorientierte Kompetenz in additiver Fertigung. Leichtbau ist dabei ein Sektor von vielen. Diese – und die anderen Leichtbau-Entwicklungen an der Hochschule – zeigen ihren Wert in konkreten Effizienzgewinnen für die Industrie und in der Hebelwirkung für regionale Partnernetzwerke. Gewicht, Energieeffizienz und Lebenszykluskosten sind die Herausforderungen, die durch derartige Leichtbau-Entwicklungen beantwortet werden können.
Wer ist Ansprechpartner für Rückfragen?
Fragen zum Projekt oder Kontakte vermittelt gerne die Pressestelle der Technischen Hochschule Mittelhessen per Mail
Tel: +49 (0) 641 309-1042
pressestelle@thm.de
Bild oben: Ein Bremssattel, der mit der 3D-Drucktechnik hergestellt wurde. (Quelle: TH Mittelhessen)
Auf diesen Beitrag bezieht sich der Leichtbaucheck:

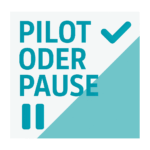
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.